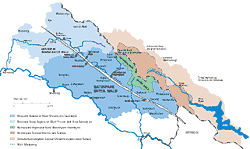 Forstamt erlaubt Naturfreunden eine Exkursion in streng geschützte Bereiche bei Haidmühle
Eigentlich ist der Zutritt zu den Haidmühler Hochmooren untersagt, doch für eine 60-köpfige Gruppe um Fritz Pfaffl aus Zwiesel, Vorsitzender des Naturkundlichen Kreises Bayerischer Wald, machte das Forstamt Neureichenau eine Ausnahme: Unter der Leitung von Dr. Helmut Linhard aus Waldkirchen und Erhard Kreuss, dem früheren langjährige Revierförster und daher Kenner diesen Gebietes, machte man sich behutsam auf den Weg und erlebte wunderbare Natureindrücke. Hochmoore oder „Filze“, wie sie in Bayern normalerweise genannt werden, entstanden vor allem dort, wo sich bei feucht-humidem Klima Torfmoose ausbreiten und in die Höhe wachsen konnten. Im Haidmühler Raum sind so seit dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10 000 Jahren Filze mit Torfmächtigkeiten von bis zu acht Metern entstanden. Das eigentliche Moor ist also höher als sein Umfeld, daher kommt der Name Hochmoor, nicht von der Höhenlage über dem Meeresspiegel. Da große Teile des Hochmoores keinerlei Kontakt mehr zum mineralienreichen Grundwasser haben und somit allein vom Regenwasser abhängig sind, ist die Versorgung mit Nährsalzen äußerst dürftig. Nur wenige Pflanzen können diese armen, saueren und nassen Standorte besiedeln, wie zum Beispiel Latsche, Spirke, Scheidiges Wollgras oder Rosmarinheide. Im Haidmühler Moor leben heute unter anderem noch Rothirsch, Birkhuhn und Kreuzotter, das Moor ist für viele ein Brutraum. Die angrenzenden Wiesenflächen werden als Balzplätze genutzt. Die Teilnehmer der Exkursion fanden auch Fährten- und Fraßspuren. Aber auch kleinere Tierchen, wie den Schmetterling Hochmoor-Gelbling oder Libellen, leben hier. Die Exkursionsroute führte zunächst in das Haidfilz, dann über eine Zwischenstrecke mit moorigen und als Weide genutzten Wiesen zum Abrahamfilz. Das Haidfilz, benannt nach dem alten Eisenhammer an der Firmiansmühle Althammerfilz, hat eine Fläche von über 40 Hektar und ist seit 1983 Naturschutzgebiet. Es ist großflächig durch Torfgewinnung ausgebeutet worden. Ab 1912, nach der Fertigstellung der Bahnlinie von Waldkirchen nach Haidmühle, begann der maschinelle Abbau. Die Trasse der alten Mooreisenbahn zwischen den beiderseitigen Torfabbaugebieten kann man noch heute erkennen. Eingestellt wurde der Torfabbau während des Krieges und schließlich im Jahr 1960. Weite Strecken des Haidfilzes waren vor Jahrzehnten mit Waldkiefern aufgeforstet worden, sie wurden in jüngster Zeit alle geschlagen, nur die Moorbirken ließ man stehen. Mitten durch das Haidfilz führt auch der Kanal, der der Kalten Moldau viel Wasser entzieht und der Haidmühler Mühle zuführt. Er wurde schon lange, bevor man mit dem Torfabbau begann, angelegt. Auf dem Weg vom Haidfilz kam die Gruppe an zahlreichen, erst vor kurzer Zeit angelegten Nahrungsteichen für den Fischotter vorbei, der sich dort in einer Restpopulation gehalten hat. Das Abrahamfilz trug früher den Namen Beerenfilz. Es ist zwar kein Naturschutzgebiet, neuerdings wird es aber als besonders interessantes und erhaltenswertes „Geotop“ eingestuft. Es handelt sich um ein Hochmoor mit einer Torfmächtigkeit von sechs bis acht Metern und großflächigem, inzwischen aufgelassenem und sich regenerierendem Torfstich im Zentrum. In letzter Zeit wurde der Abfluss vom Abrahamfilz zur Alten Moldau aufgestaut und es entstand ein vollkommen natürlich anmutender Moorsee. Die eigentliche Hochmoorfläche wird von zueinander parallelen tiefen Entwässerungsgräben durchzogen, die meist von Heidekraut so überwachsen werden, dass sie für den unvorsichtigen Wanderer zu regelrechten Fallgruben werden können. Nach der fast vierstündigen Exkursion, die für alle Teilnehmer unvergesslich schöne Bilder einer trotz aller menschlichen Eingriffe recht ursprünglichen Landschaft bot, traf man sich noch zu einem gemütlichen Ausklang.
(Quelle: Dr. Helmut Linhard Passauer Neue Presse, Waldkirchen)
|